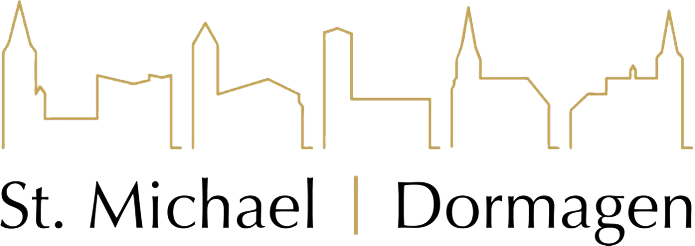Adventskalender 2025: „Die Legende des Lichts“

Die Legende des Lichts - ein Kloster-Krimi im Advent
"Draußen heulte der Wind und Schnee trieb in dichten Schwaden gegen die Mauern unseres Klosters, sodass selbst die Statue des Heiligen Benedikts am Tor kaum noch zu sehen war. Ich hatte mich gerade daran gemacht, den Eintrag des Tages zu vollenden, als ich ein fernes Schlagen an der Tür hörte...", so beginnt unsere diesjährige fiktionale Adventskalender-Geschichte.
Sie spielt in einem abgelegenen Kloster im Jahr 1701. Merkwürdige Dinge geschehen im Kloster und auch Kommissar Stein wurde Zeuge der mysteriösen Geschehnisse. Gibt es eine Verschwörung unter den Mönchen? Am Ende löst sich das Rätsel auf. Doch bis zum 24. Dezember bleibt die Geschichte spannend.
Viel Spaß mit unserem Advents-Krimi!

Kapitel 1 – Der Schneesturm
Draußen heulte der Wind und Schnee trieb in dichten Schwaden gegen die Mauern unseres Klosters, sodass selbst die Statue des Heiligen Benedikts am Tor kaum noch zu sehen war. Ich hatte mich gerade daran gemacht, den Eintrag des Tages zu vollenden, als ich ein fernes Schlagen an der Tür hörte. Zunächst leise, dann immer fordernder.
Seit vielen Wintern hatte niemand mehr um Einlass gebeten – schon gar nicht zu dieser Jahreszeit. Das nächste Dorf lag weit entfernt, und selbst die wenigen Pilger, die uns manchmal erreichten, kamen nur zu den Hochfesten und niemals inmitten eines Schneesturms.
Mit einer Laterne in der Hand stieg ich die knarrenden Stufen vom Skriptorium zur Eingangshalle hinab. Ich spürte die Kälte, die von außen in die Halle kroch. Ich hörte erneut ein Klopfen, nun begleitet von einer Stimme. Als ich den Riegel öffnete, sah ich einen Mann, eingehüllt in einen dicken Mantel, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und über und über mit Schnee bedeckt.
„Ich bitte um Einlass“, sagte er mit ruhiger, fast erschöpfter Stimme. Ich musterte ihn und versuchte, ihn einzuordnen. Ein Pilger? Ein Flüchtender? Ein verirrter Narr?
„Hier bat lange schon niemand mehr um Einlass“, antwortete ich vorsichtig. Ich hörte meine Worte härter klingen als beabsichtigt.
Er hob den Kopf und sah mich an. Seine Augen waren ungewöhnlich hell, und ihre Farbe leuchtete inmitten des weißen Schnees, der ihn bedeckte. „Ich suche Schutz. Der Sturm kam schneller, als ich glaubte. Ich werde morgen weiterziehen.“
Noch während ich abwog, erschien der Abt hinter mir. Er war leise wie immer, aber in seinem Blick lag die gleiche Entschlossenheit, die mich als Novize ehrfürchtig gemacht hatte. „Lasst ihn ein“, sagte er, drehte sich sofort um und ging, ohne sich dem Fremden vorzustellen.
Ich gehorchte, doch mir war nicht ganz wohl dabei. Vielleicht war es unbegründet, doch es schien mir, als hätte dieser Mann den Weg zu uns nicht durch Zufall gefunden. Als wäre es eine Bestimmung gewesen, dass er ausgerechnet an diesem Tag kam: Dem ersten Adventssonntag des Jahres 1701.

Kapitel 2 – Die Zustimmung des Abtes
Der Fremde erhielt eine Zelle im südlichen Gästetrakt, dem ältesten Teil des Klosters, wo die Kälte durch die Mauern kroch und der Wind durch die Fenster pfiff. Als ich ihm den Weg zeigte, fiel mir auf, wie ruhig er sich bewegte, als sei er nicht erschöpft, sondern gänzlich in Gedanken versunken. Er sprach kaum, bedankte sich leise und ließ mich dann allein. Ich schloss die Tür, blieb einen Moment im Flur stehen und sah, wie mein Atem in der Kälte sichtbar wurde. Ein gewöhnlicher Gast war er nicht. Ich wusste es, lange bevor ich einen Grund dafür hatte.
Am nächsten Morgen, nach der Laudes, ließ uns der Abt ins Kapitelhaus rufen – ein ungewöhnlicher Schritt, denn dieser Ort war festlichen Anlässen oder ernsten Beschlüssen vorbehalten. Der Raum war nur schwach vom Winterlicht durchzogen, und auf dem Gesicht des Abtes lag eine Schwere, die ich selten gesehen hatte. „Brüder“, sagte er, „wir haben einen Gast. Er wird eine Weile bei uns bleiben, bis seine Reise ihn weiterführt.“
Ein Flüstern ging durch die Reihen. Manche wirkten erleichtert, andere besorgt. Bruder Matthäus presste die Lippen zusammen, als halte er ein Urteil zurück.
Ich wagte eine Frage, die mir selbst zu kühn erschien.
„Hochwürden… hat er gesagt, wohin er unterwegs ist?“
Der Blick des Abtes traf mich – ohne Zorn, doch mit einer Autorität, die jeder von uns seit Jahren kannte.
„Er sucht“, antwortete er. „Und wer sucht, darf bei uns bleiben.“
Es war keine befriedigende Antwort, und doch war es die Antwort, die wir zu akzeptieren hatten. Ich spürte, wie Verwirrung in mir aufstieg. Nicht nur wegen der Worte des Abtes, sondern wegen seines Blicks. Für einen Augenblick schien er zu wissen, was ich fragen wollte, noch bevor ich meine Frage ausgesprochen hatte.
Nach dem Kapitel ging ich in die Kirche. Die Morgensonne war noch nicht stark genug, um durch die bleigefassten Fenster zu dringen und so war der Chorraum nur durch Kerzenschein erleuchtet. Ich kniete vor dem Tabernakel, doch mein Gebet kreiste immer wieder um dieselbe Frage: Warum war der Abt so sicher, wo doch alles an diesem Mann ungewiss war? Sah er etwas, das ich nicht sehen konnte?
Als ich den Kreuzgang entlangging, begegnete ich dem Abt. Er blieb stehen und sah mich an. Sein Blick war mild, doch undurchdringlich. „Du fragst dich, ob ich mehr weiß, als ich sage?“, sagte er ruhig.
Ich nickte, unfähig, zu lügen.
Er lächelte kaum sichtbar. „Ich weiß, dass sein Kommen kein Zufall sein kann. Mehr müssen wir vorerst nicht wissen. Vertraue auf Gott.“

Kapitel 3 – Nächtliche Gesänge
In der dritten Nacht nach seiner Ankunft wachte ich auf, ohne zu wissen, weshalb. Vielleicht war es ein Traum gewesen, vielleicht ein Geräusch. Doch dann hörte ich es wieder – leise, wie aus weiter Ferne, und zugleich so nah, als käme es aus den Steinen selbst.
Ein Gesang, doch kein Psalm, wie wir ihn in der Liturgie singen. Er war älter. Schwebend. Ein Klang, der die Luft nicht füllte, sondern durchdrang.
Ich nahm eine Kerze und schlich über die kalten Steine des Kreuzgangs. Je näher ich der Kirche kam, desto klarer wurde der Gesang und desto unbegreiflicher, dass niemand außer mir wach war.
Die Tür zur Kirche stand einen Spalt offen. Drinnen brannten die Kerzen auf dem Altar, als sei dort heimlich eine Liturgie begonnen worden. Und vor ihnen kniete der Fremde.
Sein Gesang war nicht laut. Doch er war wie Weihrauch: er erhob sich, erfüllte den Raum und legte sich schwer und heilig auf alles, was atmete. Ich blieb stehen, unfähig, mich zu rühren. Etwas in mir schämte sich, ihn zu stören – als lausche ich einem Gebet, das nicht für andere Menschen bestimmt war.
Als er aufstand, drehte er sich nicht überrascht zu mir um. Er lächelte, als hätte er gewusst, dass ich dort war.
„Manchmal braucht das Herz die Dunkelheit,“ sagte er leise, „um das Licht zu finden.“
Dann streckte er die Hand aus. Nicht fordernd. Einladend.
„Komm. Bete mit mir.“
Ich kniete mich neben ihn und ohne Absprachen begannen wir zu singen. Psalmen, die ich kannte – und Gesänge, die ich nie zuvor gehört hatte. Ich fragte mich, woher ein einfacher Pilger diese Vielzahl an Gesängen und Chorälen kannte.
Als ich am Morgen mit den Brüdern im Chor betete, waren die Kerzen gelöscht und kein Tropfen Wachs zeugte von der Nacht. Niemand sprach davon. Niemand erwähnte den Gesang in der Nacht. Und für den Rest des Tages fragte ich mich, ob ich wirklich dort gewesen war oder ob ich ein fremdes Gebet geträumt hatte, das mich nun nicht mehr losließ.

Kapitel 4 – Eine sonderbare Begegnung
Am folgenden Abend traf ich den Fremden im Klostergarten, obwohl die Temperaturen längst jeden bei Verstand in die Wärme gezwungen hätten. Er stand mit dem Rücken zu mir, die Hände verschränkt und sah in den fallenden Schnee, als lese er in ihm wie in einem Buch.
„Weshalb kamt Ihr hierher?“, fragte ich ihn ohne Umschweife.
Er lächelte, ohne sich umzudrehen. „Ich suche“, sagte er, leise wie ein Gebet.
„Wonach?“
Er ließ sich Zeit, ehe er antwortete. „Nach meiner Aufgabe.“
Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Pilger sprechen von Schuld, von Umkehr, von Wunden, die sie mit sich tragen. Doch er sprach von Aufgabe. Von Bestimmung. Und das machte ihn mir fremder als jede Sünde.
Eine Weile schwiegen wir und der Schnee fiel zwischen uns zu Boden.
Dann sagte er: „Habt Ihr nie das Gefühl, dass etwas fehlt? Etwas, das Ihr einst wusstet und nun vergessen habt? Wie ein Wort, das man auf der Zunge hat, aber nicht aussprechen kann?“
Seine Worte ließen mich frösteln. Ich dachte an die Lücken in den Chroniken, an die fehlenden Seiten in den Gründertexten, an Orte im Archiv, an denen nur Staub geblieben war, wo Bücher hätten stehen müssen.
„Manchmal“ antwortete ich. „Aber das sind nur Gedanken. Keine Zeichen.“
Er wandte sich mir nun voll zu. Sein Blick war wach und zugleich weit fort. „Vielleicht sind Gedanken Zeichen, die wir nicht mehr zu lesen wissen.“
Er verneigte sich leicht, wie ein Mönch vor dem Altar, und ging zwischen den verschneiten Büschen zurück ins Kloster.
Ich sah ihm nach, bis sein Mantel von der Dunkelheit verschluckt wurde. Plötzlich wusste ich: Er war nicht einfach gekommen – er war gerufen worden. Doch nicht von uns.

Kapitel 5 – Verschwundene Seiten
Vier Tage nach der Ankunft des Fremden entdeckte ich erstmals fehlende Bücher, als ich die Chroniken des Gründungsjahres für einen jüngeren Bruder heraussuchte. Zuerst dachte ich, sie stünden falsch. Ein seltenes Versäumnis meinerseits. Doch als ich erneut durch die Reihen ging, entdeckte ich weitere Lücken: zwei alte Psalterien, ein Stundenbuch, sorgfältig gebunden und längst nicht mehr im Gebrauch, fehlten ebenfalls.
Ich durchsuchte jeden Abschnitt. Ich zählte die Buchrücken, prüfte den Katalog, verglich Signaturen. Alles war, wie es sein sollte – bis auf das, was fehlte.
Ich befragte meine Brüder. Niemand konnte etwas zu dem Verschwinden der Bücher sagen. Manche reagierten mit ehrlicher Bestürzung, andere mit gleichgültigem Achselzucken.
Nur der Abt blieb seltsam ruhig. „Vielleicht hast du dich geirrt“, sagte er mit mildem Tonfall und ohne Vorwurf. Doch ich kannte jedes Regal so gut wie die Linien meiner Handfläche. Ich irrte mich nicht.
Am Mittag begegnete ich dem Fremden in der Bibliothek. Er stand im Gegenlicht des Fensters, als beobachte er den Staub, der in der Luft tanzte.
„Es riecht hier nach Geschichte“, sagte er mit leiser Ehrfurcht.
„Und jemand stiehlt sie“, antwortete ich.
Er lächelte nicht. Er entschuldigte sich nicht. Er sagte nichts. Aber in seinen Augen lag ein Wissen, das mich frösteln ließ.
Erst in jener Nacht, als ich allein an meinem Schreibpult saß, wagte ich den Gedanken zu Ende zu denken:
Dass seine Anwesenheit und das unerklärliche Verschwinden nicht zufällig zur selben Zeit begonnen hatten.

Kapitel 6 – Der Schlüssel der Bibliothek
Es war Bruder Matthäus, der mich im ersten Licht des Tages aufsuchte. Der Schnee lag wie eine bleiche Haut über dem Hof, und der Atem fror ihm an den Lippen. Seine Hände waren ineinander verschränkt, als verharre er in einem fortwährenden Gebet.
„Ich habe nachgedacht“, begann er schließlich. „Die Bibliothek war abgeschlossen, als wir gestern zur Komplet gingen. Der Schlüssel lag bei dir. Und ein Schlüssel beim Abt.“
„Ich habe den Schlüssel nicht aus der Hand gegeben“, erwiderte ich. Meine Stimme war ruhig, aber mein Herz nicht.
Matthäus senkte den Blick. „Dann bleibt nur einer.“
Er sprach den Namen nicht aus. Er musste es nicht. Der Gedanke stand zwischen uns wie der kalte Wind.
Doch ich dachte an einen anderen – an jemanden, der sich ohne Schlüssel Zugang zum Skriptorium verschafft haben könnte.
Am Nachmittag suchte ich den Abt auf. Ich wählte meine Worte sorgfältig, stellte keine Anklage, sondern stellte nüchtern fest: „Etwas ist hier nicht in Ordnung.“
Er hörte aufmerksam zu. Er war nie ein Mann, der flüchtig sprach. Dann sagte er leise: „Vertraue darauf, dass nichts verloren geht, das nicht zu seiner Zeit wiederkehrt.“
Ich verließ ihn mit zwei widersprüchlichen Gewissheiten:
Ich vertraute ihm.
Und ich begann, ihm nicht mehr zu trauen.
In jener Nacht, als ich allein mit den Büchern war, dachte ich erstmals, dass unsere Ordnung nicht zerschlagen worden war. Sie war geöffnet worden. Nicht wie ein Dieb, der sich mit finsteren Motiven Zugang verschafft, sondern wie ein Pilger, der eine Tür findet. Er will dort nichts stehlen, sondern eintreten und zu Gast sein.
Und die Frage blieb: Wer war der Fremde? Ein Pilger – oder ein Dieb?

Kapitel 7 – Die verschwundene Kiste
Die Kiste stand seit Jahrzehnten in einer Nische im Skriptorium. Sie war aus dunklem Holz und vom Alter gezeichnet. Auf dem Deckel befand sich ein verschlissenes Siegel, das nicht einmal der Abt entziffern konnte. Der Schlüssel, so erzählte man, sei längst verloren. Manche behaupteten er habe nie existiert.
Doch die Kiste war mit schönen goldenen Applikationen verziert, die sie vor vielen Jahren erstrahlen ließen. Ich hatte sie immer als Relikt betrachtet, als ein Rätsel ohne Lösung. Jedoch als ein schönes Relikt, weshalb ich sie bei meinem Amtsantritt an einem gut sichtbaren Platz im Skriptorium aufstellte.
Doch an diesem Morgen war sie verschwunden.
Ich fand nur den Abdruck im Staub, dort wo sie jahrelang gestanden hatte. Kein Bruch im Schloss, kein aufgebrochenes Türblatt wies auf einen Einbruch hin. Es war, als wäre die Kiste von selbst verschwunden.
Als ich dem Abt Bericht erstattete, sah ich etwas in seinem Blick, das ich noch nie gesehen hatte: keine Furcht, keine Überraschung, sondern tiefe Genugtuung. Sie flackerte nur kurz auf, wie der Schatten einer Flamme, bevor er sich wieder fasste.
„Vielleicht hat sie ihren Weg gefunden“, sagte er schließlich. Und in seinen Worten lag kein Trost. Eher so etwas wie Erleichterung. Ich wusste nicht mehr, ob er ein Hüter oder ein Mitwisser war.

Kapitel 8 – Die Polizei kommt
Es war Bruder Remigius, der darauf bestand, die weltliche Obrigkeit einzuschalten. „Wenn Dinge verschwinden, die Gott geweiht sind, ist Schweigen schuld“, sagte er. Also schickten wir einen Boten hinab ins Tal. Die Welt lag friedlich und starr unter der unberührten Schneedecke.
Vier Tage später traf er ein: Inspektor Jakob Stein. Ein Mann um die Mitte seines Lebens, mit ausdruckslosem Gesicht und Augen, die alles sahen und nichts glaubten, was sie nicht sahen. Er kam zu Fuß, da sein Pferd krank war. Er war vom Wind gezeichnet, erschöpft, hungrig und bereits verärgert, noch bevor er ein einziges Wort mit uns gewechselt hatte.
„Ich werde nicht beten“, sagte er, als der Abt ihn begrüßen wollte. „Aber ich werde tun, weshalb ich hier bin.“
Es war keine Unhöflichkeit. Nur eine Feststellung.
Während er durch das Kapitelhaus ging, fiel sein Blick auf die Mauern, die Ikonen und Bilder und unsere Gesichter. Ich hatte den Eindruck, er sehe keinen lebendigen Ort, sondern ein Fossil.
Als ich ihm Bericht erstattete, hörte er zu ohne eine Regung zu zeigen.
„Bücher, Kerzen, eine alte Kiste“, murmelte er schließlich. „Das ist kein Verbrechen. Das ist Unordnung. Vielleicht ein Irrtum. Vielleicht ein Spiel, das jemand mit Ihnen treibt.“
„Und wenn es kein Mensch war?“, fragte ich, ehe ich darüber nachdenken konnte.
Er sah mich an, müde und scharf zugleich. „Dann ist es ein Mensch, der so handelt, dass man ihn für etwas Anderes hält.“
Da erkannte ich, dass uns der Fremde etwas geöffnet hatte. Inspektor Jakob Stein jedoch nicht gekommen war, um uns zu helfen diese Offenbarung zu verstehen, sondern um in seinen Augen beliebige Objekte wiederzufinden.

Kapitel 9 – Erste Befragungen
Inspektor Stein begann seine Ermittlungen auf eine Weise, die ihm eigen war: schweigend. Er stellte keine Fragen, drohte nicht, weckte keine Schuldgefühle – er setzte sich einfach einem Bruder gegenüber, und irgendwann kam ein einziger Satz, so scharf wie ein Messer.
„Wo waren Sie, als die Kiste verschwand?“
Oder: „Was bedeutet Ihnen die Geschichte Ihres Klosters?“
Dann wartete er.
Und das Schweigen tat den Rest.
Ich musste mir eingestehen: Er besaß eine Gabe. Die Brüder sprachen nicht, um sich zu verteidigen – sie sprachen, um die Stille zu brechen. Und Stein hörte nicht nur auf ihre Worte, sondern auf das, was zwischen ihnen fiel.
Er schrieb kaum etwas nieder, doch ich wusste, er vergaß nichts. Seine Augen blieben ruhig und prüfend. Es schien, als sei er nicht hergekommen, um Schuldige zu finden, sondern um die Welt wieder in Ordnung zu bringen, weil er nicht ertrug, dass sie nicht geordnet war.
Als ich mit ihm allein war, stellte er mir keine einzige Frage. Stattdessen blieb sein Blick auf dem großen Katalog hängen, in dem alle Schriften des Klosters verzeichnet waren.
„Manchmal verbergen Menschen etwas. Nicht, weil sie es besitzen wollen“, sagte er leise, „sondern weil sie fürchten, dass ein anderer etwas entdeckt, was sie selbst nicht mehr wissen.“
Ich wusste nicht, ob seine Worte mir galten. Aber in dieser Nacht begann ich mich zu fragen, ob irgendjemand in diesem Kloster wirklich wünschte, dass die Wahrheit ans Licht kam.

Kapitel 10 – Der Fremde verschwindet
Den Fremden konnte Inspektor Stein nicht befragen. Seit jener Nacht, in der ich ihn singend in der Kirche gesehen hatte, mied er jede Gemeinschaft. Er verließ das Kloster bei Tagesanbruch und kehrte erst zurück, wenn die Brüder längst schliefen. In den Speisesaal kam er nicht mehr. Es war, als lebe er einen anderen Rhythmus als wir.
Auch am Morgen der Befragungen war er fort gewesen. Nicht abgereist – fort. Sein Bett lag glatt wie zuvor, als hätte niemand jemals darin geruht. Sein Mantel, der noch gestern im Flur gehangen hatte, war verschwunden. Im frischen Schnee entdeckten wir Spuren, doch sie führten nicht hinaus zum Tor. Sie brachen ab zwischen Kirche und Kräutergarten, mitten im reinen Weiß, als hätte der Schnee selbst ihn verschluckt.
Der Abt sah die leeren Räume und sagte nur mit leiser Stimme:
„Vielleicht hat er gefunden, was er suchte – und ging weiter.“
In seinem Ton lag kein Erstaunen, nur ein Wissen, das ich nicht verstand.
Der Inspektor dagegen sprach hart, beinahe triumphierend:
„Er wusste etwas. Und er wusste, dass ich es herausfinden würde.“
Von diesem Augenblick an wurde alles, was uns fehlte, an ihm festgemacht:
Die Handschriften, die Kiste aus dem Archiv und Kerzen, die aus der Sakristei verschwanden.
Es war, als hätten wir der Unruhe nun endlich ein Gesicht verliehen und zugleich hatte sie keines mehr.
Doch während die Brüder Sicherheit im Verdacht suchten, dachte ich an sein Gesicht in der Kapelle, an einen Ausdruck, der mich mehr an Gnade als an List erinnerte. Ich konnte nicht glauben, dass er geflohen war.
Ich begann zu ahnen, dass sein Verschwinden kein Ende war.

Kapitel 11 – Die Unruhe wächst
Die Tage wurden kürzer, und mit ihnen schien das Schweigen zu wachsen. Es kroch in die Gänge, legte sich schwer auf die Mauern des Klosters und setzte sich wie Reif auf unsere Stimmen. Selbst im Chorgebet klang der Gesang angespannter, brüchiger, als würde jede Stimme nicht Gott, sondern dem eigenen Verdacht antworten.
Inspektor Stein duldete keine Abweichung mehr. Er hatte Regeln aufgestellt. Die Regel des Heiligen Benedikt galt noch, doch sie stand nun im Schatten einer anderen Ordnung, einer weltlichen und einer hart wie Eisen.
Manche Brüder rebellierten im Stillen. Sie sagten, es sei besser, Bücher zu verlieren als das brüderliche Vertrauen.
Und ich? Ich beobachtete und schrieb.
Immer wieder fragte ich mich, ob wir wirklich bestohlen worden waren oder ob uns lediglich etwas entglitt, das nie unser Besitz gewesen war. Je länger ich darüber nachdachte, desto deutlicher spürte ich, dass es nicht um Dinge ging. Nicht um Holz oder Pergament.
Es ging um Wissen, das uns schon längst verloren gegangen war.
Und um Geheimnisse, die älter waren als wir.

Kapitel 12 – Stimmen der Brüder
Es begann mit einem Gespräch nach der Komplet. Wir saßen im Skriptorium, und einer nach dem anderen gestand, dass er etwas bemerkt hatte. Nichts Großes, aber zusammengenommen war es unheimlich.
Fässer mit Winterbier, die niemand ausgeschenkt hatte. Lebensmittel, die verschwanden, als müsste eine unsichtbare Gemeinschaft versorgt werden. Fußspuren im Schnee, die nicht zum Kloster führten, sondern von ihm weg. Tiere im Wald, die nachts aufgeschreckt wurden.
Der Inspektor hörte zu, die Stirn in Schatten gelegt, und sagte nur:
„Entweder lebt unter euch jemand, den ihr nicht kennt – oder jemand kommt und geht, ohne gesehen zu werden.“
Noch am selben Tag durchsuchten wir das Kloster. Wir klopften Wände ab, suchten nach alten Gängen, in denen einst vielleicht Mönche vor Gefahr flüchteten. Nichts. Keine Spuren außer der Gewissheit, dass etwas da war.
Als wir allein im Kreuzgang standen, fragte Inspektor Stein mich plötzlich:
„Warum tun Sie das? Warum lebt ein Mann wie Sie hier?“
Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass er es ernst meinte.
„Weil ich etwas suche, was nicht vergeht“, sagte ich. „Ich wusste nicht, wie man lebt, wenn alles, was man tut, nur dem eigenen Vorteil dient. Ich wollte frei sein – und fand heraus, dass man Freiheit dort findet, wo man sich in den Dienst anderer stellt.“
Der Ermittler sah mich lange an. „Ich kann nichts glauben, dass ich nicht beweisen kann.“
„Und ich glaube“, antwortete ich, „weil ich weiß, dass ich nie alles beweisen kann.“
Das war das erste Mal, dass er schwieg, ohne Widerspruch.
Er setzte sich in Bewegung, drehte sich aber noch einmal um:
„Wenn es eine Wahrheit gibt, werde ich sie finden – mit oder ohne Ihren Gott.“
Am nächsten Morgen verließ er das Kloster, um ins Tal zu reisen.

Kapitel 13 – Das Dorf
Das nächste Dorf lag in einer Senke, halb von Nebel, halb von Schnee verschluckt. Es war klein und ärmer, als Inspektor Stein erwartet hatte – doch es hatte eine Ruhe, die ihn irritierte.
Zuerst schwiegen die Menschen. Ein Fremder war nie ein willkommener Anblick. Doch schließlich tauten sie auf, wie der Schnee um das Feuer.
Sie erzählten von einer Legende aus alten Tagen, als das Kloster zur Weihnacht noch ein Ort der Begegnung gewesen war. Zum Hochfest der Geburt Christi sei man stundenlang durch die Nacht gelaufen, um zur Messe zu gelangen. Aber irgendwann habe sich etwas verändert.
„Das Kloster ist zur Weihnacht… still geworden“, sagte eine Frau mit rauen Händen. „Nicht fromm still. Tot still.“
Ein alter Fischer ergänzte:
„Mein Urgroßvater kam damals in der Heiligen Nacht zum Kloster. Die Türen standen offen. Kein Licht. Keine Stimmen. Keine Menschen. Aber die Räume waren warm, als hätten sie den Ort gerade erst verlassen.“
Seit jener Nacht war niemand mehr vor Tagesanbruch hinaufgegangen.
„Man braucht nicht anzuklopfen,“ murmelte der Fischer, „denn niemand wird antworten.“Niemand sprach schlecht über das Kloster – doch ebenso wenig sprach jemand mit Sehnsucht davon. Man sagte, die Mönche kämen manchmal ins Dorf, freundlich, wie immer.
Und als Stein später in der Herberge lag, das Knistern des Holzes im Kamin hörend, fragte er sich, ob er noch einem Verbrechen folgte.
Oder schon einer Legende.

Kapitel 14 – Rückkehr
Zwei Tage später kehrte Inspektor Stein zurück. Er war stiller als zuvor. Nicht skeptischer, sondern nachdenklicher.
Er stand im Kreuzgang, als ich ihn fand, und sah dem fallenden Schnee zu. Er schwieg lange und sagte schließlich nur einen Satz:
„Ich weiß, dass hier etwas geschieht, das nicht in meine Berichte passt. Etwas, das ich nicht erklären kann.“
Doch er weigerte sich, das Übernatürliche auch nur in Betracht zu ziehen. Für ihn musste es eine Logik geben – einen Willen, einen Fehler, einen Mechanismus, den er noch nicht verstand.
Ich fragte, was er tun würde.
„Beobachten“, sagte er. „Nicht mehr suchen, sondern warten.“
In diesem Moment begriff ich: Er hatte aufgehört, nach einem Täter zu suchen. Er suchte nun nach einem Sinn.

Kapitel 15 – Ein nächtlicher Schritt ins Nichts
In jener Nacht wachte ich erneut auf. Doch diesmal stand ich nicht auf. Ich wartete.
Dann hörte ich es: Schritte im Schnee. Langsam. Bedächtig. Nicht wie ein Eindringling – eher wie ein Pilger.
Ich ging zum Fenster, sammelte meinen Mut und blickte hinaus.
Und dort, im weißen Halbdunkel, stand er. Der Fremde.
Nur in ein Gewand gehüllt, das einer Mönchsrobe ähnelte – ohne Mantel, ohne Schuhe.
Barfuß. Als wärmten die Schneeflocken selbst seine Füße.
Er sah nicht zu mir. Er blickte zur Kapelle. Dann machte er einen Schritt auf die Kapelle zu.
Und verschwand.
Nicht hinter einem Baum. Nicht hinter einem Schatten. Es war, als hätte der Schnee ihn verschlungen.
Ich sank an die Wand herab. Ich zitterte nicht vor Furcht, sondern vor Erkenntnis. Es war derselbe Fremde, den ich seit jener Nacht in der Kirche nicht mehr gesehen hatte. Und er war verschwunden wie jemand, der nie existiert hatte.
Ich lauschte – hoffte auf seinen Gesang. Doch da war nichts. Nur Stille.
Also zog ich meinen Mantel an und ging zur Kirche.
Am Ende des Kreuzgangs sah ich einen Schatten – kaum mehr als ein Umriss in der Dunkelheit der Nacht.
Dann fiel die Tür zur Sakristei ins Schloss.
Ich rannte, riss sie auf – und fand nur Dunkelheit.
Keine Person, keine Spur. Nichts.
Auch draußen auf dem frisch gefallenen Schnee sah ich nur die Fußspuren meiner Mitbrüder. Keine Spur von nackten Füßen.
Etwas geschah hier, das ich noch nicht begreifen konnte.

Kapitel 16 – Ein Zeichen in der Kirche
Am Morgen fand Bruder Aurelius eine Kerze auf dem Altar. Doch es war keine von uns.
Sie war aus Bienenwachs gegossen, doch von einer Farbe, die kein Wachs je gehabt hatte. Sie war hell wie eine Flamme, die sich selbst in Form gegossen hat und war nicht abgebrannt. Und doch roch es, als sei sie erst vor kurzem gelöscht worden.
Daneben lag ein kleiner Fetzen Pergament.
Die Schrift war unruhig – wie von jemandem geschrieben, der in großer Eile gewesen sein muss.
„Er kommt in der Nacht der Erlösung.“
Für den Inspektor war es ein Hinweis. Eine Handschrift, ein Hinweis auf den möglichen Täter.
Für die Brüder wurde es zur Glaubensfrage: Warnung oder Prophezeiung?
Der Abt jedoch sah das Pergament nur an und lächelte. Er wirkte nicht beunruhigt, sondern strahlte jene traurige Gewissheit aus, die nur jemand hat, der sich an etwas erinnert, was alle anderen vergessen haben.
Ich sagte nichts. Aber in mir wuchs die Überzeugung:
Dies war kein Zeichen eines Diebes.
Es war eine Verheißung. Und ich wagte, sie zu deuten. Schließlich geschah all dies in der Adventszeit.

Kapitel 17 – Der Abt schweigt
Seit der Botschaft in der Kirche spürte ich, wie sich eine unsichtbare Linie durch unseren Konvent gezogen hatte – zwischen denen, die wissen wollten und jenen, denen alles gleichgültig war.
Und der Abt stand genau dazwischen.
Bei den Mahlzeiten, selbst während der Messe, wirkte er abwesender denn je – als warte er nicht auf die Wandlung, sondern auf etwas Älteres, das ihr vorausging und doch mit ihr zusammenhing.
Der Ermittler stellte ihm schließlich die Fragen, die alle beschäftigten, aber niemand auszusprechen wagte:
„Was ist damals zur Gründungszeit geschehen?
Warum sollte jemand Aufzeichnungen aus dieser Epoche stehlen?
Und warum werde ich das Gefühl nicht los, dass all das miteinander verbunden ist?“
Der Abt lächelte. Nicht spöttisch, sondern beruhigend und wandte sich an mich und meine Brüder.
„Ich schütze nicht euch. Ich schütze das, was euch anvertraut wurde.
Alles wird offenbar werden, wenn es an der Zeit ist.“
Ich selbst war Zeuge dieses Gesprächs. Und fühlte mich zugleich als Mitwisser und Fremder.
Es war, als redete er nicht über Bücher oder Kisten – sondern über den Glauben selbst.
In derselben Nacht fand ich den Abt allein in der Kirche, betend vor dem Tabernakel.
„Der Mensch vergisst“, flüsterte er. „Er verliert den Blick. Doch das Licht ist stärker als das Vergessen.“
Ich wagte nicht zu fragen, was er meinte.
Denn ich ahnte, dass die Antwort größer war, als ich verstehen wollte.
Also kehrte ich ins Skriptorium zurück, um in meinen Büchern eine Antwort zu suchen.

Kapitel 18 – Spuren im Schnee
Der Ermittler begann erneut, das Gelände systematisch zu untersuchen. Er errichtete Markierungen, kontrollierte Pfade, beobachtete jede Spur im Schnee wie einen Text, den er lesen wollte.
Doch die Spuren blieben nicht.
Was am einen Morgen vorhanden war, war am nächsten verschwunden-, als habe der Schnee selbst beschlossen, nicht als Zeuge zu dienen.
„Es ist, als wolle uns jemand narren“, murrte Inspektor Stein.
Dann geschah etwas, das selbst ihn verstummen ließ:
An einem Morgen fand er Kniespuren.
Eine Linie im Schnee, wie von einem Menschen, der betend über das Gelände gekrochen war, bis hinunter in den Wald.
Die Spuren begannen am Kloster und endeten vor einem kleinen Hügel im Wald. Als hätte dort jemand gekniet und sei dann einfach verschwunden.
„Das war kein Dieb“, sagte ich leise.
„Doch“, erwiderte der Inspektor. „Aber einer, der vorgibt, keiner zu sein. Hier müssen wir suchen.“
Wir suchten. Wir fanden nichts.
In meinem Inneren hallte der Satz aus der Kirche nach:
Er kommt in der Nacht der Erlösung.
Und da begriff ich:
Er war bereits gekommen. Wer auch immer er sein mochte.

Kapitel 19 – Die letzten Seiten
Während der nächsten Tage nahmen uns die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest vollständig in Anspruch. Doch die Freude war gedämpft. Wir warteten nicht nur auf die Ankunft des Herrn – wir warteten auch auf die Rückkehr des Fremden. Sein Auftauchen, seine Spur, all das lag wie ein unsichtbarer Schleier über unseren Gedanken.
Und dann, sei es Zufall oder Fügung, fand ich eine Handschrift, die ich bisher übersehen hatte. Sie war dünn, umfasste nur wenige ungebundene Seiten altes Pergament.
Doch ich erkannte die Schrift sofort: Die des ersten Chronisten.
Er schrieb von einer heiligen Flamme. Von zwei Brüdern und einer Grotte, in der ihnen einst die Mutter Gottes erschienen sein soll.
Und dann stand dort ein Satz, der mich sofort aufhorchen ließ:
„Wenn Schlüssel und Truhe getrennt werden, erlischt das Licht nicht.
Doch erst wenn sie wieder vereint werden, offenbart sich das wahre Wunder.“
In diesem Moment verstand ich:
Die Kiste war nicht nur ein Gegenstand.
Es gab einen Schlüssel, der sie öffnete, und jemand wollte beides wieder zusammenführen.
Ich lief zu Stein und legte ihm die Seiten vor. Er las schweigend, dachte lange nach und sagte schließlich:
„Manchmal ist das, was wir Legenden nennen, ein Teil der Wahrheit. Vielleicht… fehlt mir einfach der andere Teil.“
Es war das erste Mal, dass er seine kalkulierte, berechnende Art ablegte.

Kapitel 20 – Das Missverständnis
Unter den Brüdern sprach man viel über meine Entdeckung.
Einige hielten die Geschichte der Kerze für eine überhöhte Legende und eine fromme mittelalterliche Übertreibung.
Doch manche schenkten ihr Beachtung – so wie ich. Nur der Abt schwieg und vermied jedes Gespräch über meine Entdeckung.
Am Morgen des 23. Dezember brach die Anspannung. Der Inspektor stellte den Abt erneut zur Rede, doch ohne Zurückhaltung und Höflichkeit.
„Sie decken jemanden“, sagte er. „Sie behindern meine Arbeit. Wenn Sie weiter schweigen, muss ich gegen Sie vorgehen.“
Der Abt sah ihn lange an. „Ich decke niemanden“, antwortete er. „Ich bewahre etwas, das größer ist als Schuld oder Unschuld. Doch bald soll es auch euch offenbar werden“.
Zum ersten Mal verlor Stein die Beherrschung. „Ich bin nicht hier, um an ein Wunder zu glauben“, sagte er scharf. „Ich bin hier, um ein Verbrechen aufzuklären.“
„Dann klären Sie es auf. Aber vergessen Sie nicht:
Nicht alles, was verborgen ist, ist falsch.
Und nicht alles, was sichtbar ist, ist wahr.“
In diesem Moment spürte ich, dass etwas zwischen ihnen zerbrach.
Und zugleich etwas Neues begann. Stein wandte sich wütend ab und ging hinaus in den Wald.

Kapitel 21 – Zeichen im Wald
Am Abend kehrte Inspektor Stein zurück. Er wirkte verändert, stiller und weniger verbissen.
Ohne viele Worte bat er mich, mit ihm zu kommen. Wir gingen in den Wald, zu jenem Ort, an dem die Kniespuren geendet hatten.
Auf der Lichtung bei dem Hügel hatte er etwas entdeckt:
Einen Kreis aus frischen Tannenzweigen und Kerzenstumpfen – geformt wie ein Adventskranz.
Kein Schnee lag auf den Zweigen.
Und alle vier Kerzen waren kürzlich entzündet worden.
Daneben lag ein Stück Pergament.
Darauf stand in derselben unruhigen Schrift wie auf dem Pergament, das wir in der Kirche gefunden hatten:
„Die Flamme wartet auf den Schlüssel.“
Für einen Augenblick sahen wir uns an.
Es gab nur zwei Möglichkeiten:
Entweder spielte jemand ein Spiel mit uns -
oder jemand erinnerte sich an etwas Größeres, das wir vergessen hatten.
Und plötzlich wusste ich, ohne Beweis, nur mit innerer Gewissheit:
Wir mussten am nächsten Tag aufbrechen.
Nicht weil wir einen konkreten Hinweis gefunden hatten, sondern weil es Zeit war.

Kapitel 22 – Die Grotte
Der Inspektor und ich brachen im Morgengrauen auf. Der Abt hatte sich, trotz meines Drängens, geweigert, weitere Brüder von ihren Pflichten zu entbinden.
Inspektor Stein kommentierte dies voller Misstrauen.
Wir erreichten die Lichtung, auf der wir am Vorabend den Adventskranz gefunden hatten. Jetzt lag dort nur noch Schnee, als wäre nichts geschehen oder als hätte jemand alles sorgfältig zurückgenommen.
Immer tiefer führte Stein mich in den Wald, schweigend ohne jede Erklärung.
Ich fragte mich, ob wir wirklich suchten oder ob er vielleicht geführt wurde.
Dann sah ich sie.
Eine Senke im Schnee, so still, als würde selbst der Wind sie meiden.
Und darin lag die Kiste. Sie war verschlossen und wirkte äußerlich heil. Ich konnte den Blick nicht von ihr abwenden. Inspektor Stein riss mich aus meinen Gedanken.
„Wir haben gefunden, was wir suchten“, sagte Stein, aber seine Stimme war alles andere als erleichtert.
„Doch nichts erklärt sich.“
Er wollte abreisen. Noch bevor wir den Rückweg antraten, sagte er es.
„Ich bleibe hier nicht über Weihnachten. Nicht eine Stunde länger als nötig.“
Er sprach von Vernunft, aber ich sah Angst in ihm. Nicht die Angst vor einem Täter, sondern vor etwas, das sich jeder Logik entzog.
Doch Petrus entschied anders.
Ein Schneesturm brach über das Tal herein und schnitt uns von der Welt ab. Er musste bleiben und ich ahnte, dass dies kein Zufall gewesen sein konnte.

Kapitel 23 – Die Rückkehr des Fremden
Am Abend des 24. Dezember, kurz nach der Vesper, klopfte jemand stürmisch an das Haupttor.
Ich öffnete und sah den Fremden im Schnee. Er hatte die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass nur sein Mund zu erkennen war. „Ich muss mit dem Abt sprechen“, sagte er. Seine Stimme zitterte nicht, doch in seinen Augen lag eine Unruhe, die nicht von Müdigkeit kam.
Wieder tobte draußen ein Schneesturm.
Wie in jener Nacht, als er zum ersten Mal vor unserm Tor stand.
Der Ermittler wollte ihn verhören, ich wollte ihn befragen - aber der Abt war schneller.
Ohne ein Wort führte er den Fremden in sein Zimmer und schloss die Tür.
Wir blieben wartend zurück im Dunkel des Kreuzgangs.
Als die Tür sich endlich öffnete, trat der Fremde heraus.
Der Abt ging schweigend hinter ihm her. Er sagte kein Wort des Abschieds, sprach kein Gebet. Und doch schien endgültig alles gesagt worden zu sein.
Der Fremde verließ das Kloster durch den hinteren Ausgang.
Nur mit einer Kiste in der Hand.
Ob es die Kiste war, konnten wir nicht erkennen.
Wir folgten ihm in den Schnee. Denn wir fragten uns nicht mehr, ob er verschwinden würde, wir fragten uns, wohin er verschwand.

Kapitel 24 – Die Legende des Lichts
Der Sturm verschlang die Welt, und wir hatten Mühe, dem Fremden zu folgen. Sein Licht tauchte zwischen den Bäumen auf und verschwand wieder, wie ein Irrlicht, das uns prüfte. Kein Wort fiel zwischen uns.
Er führte uns tiefer in den Wald, als wir je gegangen waren. Und dann blieb er unvermittelt stehen. Ein Felsen ragte vor uns auf. Ich war sicher diesen Ort nie zuvor gesehen zu haben.
Als wir den Felsen umrunden wollten, war der Fremde verschwunden. Doch hinter dem Felsen leuchtete etwas. Ein schmaler Spalt, kaum breit genug, um hindurchzugehen, funkelte in warmem Licht. Wir traten ein.
Die Grotte lag vor uns wie ein verborgenes Heiligtum. Die Wände glommen im Licht zahlloser Kerzen – Kerzen aus unserer eigenen Sakristei. Auf einem Altar aus groben Steinen lagen Stoffe, die Bruder Aurelius verloren geglaubt hatte. Und davor kniete der Fremde und betete. Vor ihm stand die Holzkiste.
Wir wollten ihn ansprechen – doch Schritte hallten hinter uns. Der Abt war gekommen, und mit ihm mehrere Brüder. Inspektor Stein trat vor, bereit zu fragen. Doch der Abt sprach zuerst.
„Unsere Chroniken erzählen von zwei Brüdern“, begann er. „Sie zogen in einer Nacht wie dieser durch einen Sturm, suchten Schutz – und fanden ihn hier. In dieser Grotte.“
Er sah zu uns, als wolle er sichergehen, dass jeder ihm aufmerksam zuhörte.
„Und dort erschien ihnen die Mutter Gottes. Um sie zu retten und um sie zu senden. Sie gab ihnen eine Flamme, die sie wärmte, aber nie erlischt, und eine Kiste, die sie bergen sollten. Der eine hütete die Flamme, der andere den Schlüssel. Und Jahr um Jahr trafen sie sich hier in der Heiligen Nacht – bis ihre Wege sich verloren.“
Er schwieg einen Moment, und der Sturm draußen schien den Atem anzuhalten.
„Misstrauen kam auf. Die Mönche beobachteten ihren Abt, verfolgten ihn, doch er verbarg den Weg, um das Geheimnis zu schützen. Am Ende blieben nur die Tradition und die Furcht, sie wieder aufzunehmen. Diese Furcht wurde schließlich an jeden neuen Abt weitergegeben, so auch an mich. Auch ich hatte zunächst Angst, dass das Geheimnis offenbar wird, doch wusste ich nicht warum. Abt Bernhard überzeugte mich schließlich, die Legende zu ergründen und so schickte er Bruder Gregor zu mir. Gemeinsam suchten wir, das Geheimnis zu ergründen und fanden Hinweise in der ersten Chronik unseres Klosters. Wir zogen euch nicht ins Vertrauen, bis wir sicher waren, dass die Legende der Wahrheit entsprach. Bis zum heutigen Heiligen Abend."
Er sah den Fremden an, der sich nun als Bruder Gregor aus unserem Nachbarkloster herausgestellt hatte.
„Bis heute.“, sagte dieser.
Niemand sprach, denn in diesem Moment begriffen wir, dass die Überlieferung nicht vergessen worden war, sondern nur aus Furcht versteckt wurde. Und dass der Fremde nicht gekommen war, um zu nehmen, sondern um zurückzugeben.

Kapitel 25 – Die Wiederkehr des Lichts
Kurz nachdem unser Abt mit seiner Erzählung geendet hatte, hörten wir Stimmen von draußen. Es waren die Mönche aus unserem Nachbarkloster, die, genau wie wir, mit ihrem Abt auf dem Weg zur Grotte waren.
„Bruder Gregor, bitte“, sagte unser Abt. Es war eine Bitte, die der Fremde ohne Zögern verstand.
Er erhob sich, öffnete die Kiste mit dem alten Schlüssel und darin lag eine Kerze.
Die Kerze brannte, ohne zu versiegen; das Wachs zeigte keine Furchen, als würde sie eine Flamme formen, die nicht an ihr zehrte.
Ihr Licht füllte die Grotte, so hell wie kein Kerzenlicht es jemals könnte. Wärme strömte von ihr aus, nicht wie die einer Flamme, sondern wie die eines Herzens.
Der Inspektor trat vor, bleich, fast erschrocken. Er beugte sich über die Flamme und versuchte, sie zu löschen, doch sie regte sich nicht.
Da geschah etwas in seinem Blick, keine Verzweiflung, sondern Erkenntnis.
Ein Mensch, der zum ersten Mal zugibt, dass seine Welt größer ist, als er sie je zugelassen hat.
Wir fielen nicht auf die Knie und beteten, weil wir ein Wunder erwarteten, sondern weil wir inmitten eines standen, und beteten. Während die Litanei erklang, sah ich es: eine Bewegung am Rand des Lichts.
Ein Umriss, wie eine Gestalt mit einem Kind im Arm.
Ich fuhr herum, doch da war niemand.
Nur der Stein und das Licht der Kerze.
Ich schwieg. Doch ich wusste: Auch er hatte es gesehen.
Der Inspektor blieb kniend. Seine Hände zitterten nicht mehr. Er sah nicht mehr aus wie ein Mann, der etwas bekämpfte, sondern wie einer, der endlich aufgehört hatte, sich zu verteidigen.
Und dann – leise, fast schüchtern – stimmte er in unser Gebet ein.